Stilepochen
Ich male in Ihrem Auftrag Originale und Kopien von Gemälden sämtlicher Stilepochen sowie stilistische Imitationen eines jeden Künstlers, sofern dadurch das Urheberrecht nicht verletzt werden würde.
Für Fragen oder Wünsche nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Ich antworte schnellstmöglich.
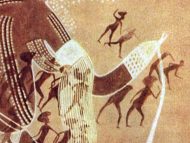
Alles begann mit der Höhlenmalerei. Bereits in der Steinzeit und auf allen Erdteilen gab es Künstler, die verschiedene Mal- und Gravurtechniken nutzten, um zumeist rituelle oder mythologische Fruchtbarkeits-, Natur- und Jagdszenen auf Fels zu verewigen. Dabei gab es bereits höchst unterschiedliche Techniken. Die verwendeten Farbpigmnete waren durchweg natürlichen Ursprungs und wurden zumeist aus Tonerden, Kalkstein und Ruß gewonnen. Sogar Pinsel aus Tierhaaren fanden bisweilen schon Verwendung, auch wenn die Technik des "Aufstäubens" mittels Röhrenknochen wesentlich verbreiteter war. Objektiv betrachtet finden sich in der Jungsteinzeit bereits Werke, die in Ihrer künstlerischen Qualität die Werke manch eines Zeitgenossen deutlich überteffen. Und schon damals signierten die Künstler ihre Werke, indem sie die Umrisse ihrer Hand auf dem Fels hinterließen.

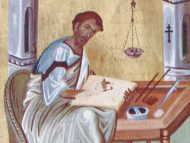
Wurden bislang Figuren, Tiere oder Objekte zumeist isoliert dargestellt, gewann nun allmählich die Darstellung im Kontext immer mehr an Bedeutung. Der Mensch wurde in seiner Umwelt abgebildet, und mehr und mehr löste sich die Malerei von ihrer religiösen und kultischen Bedeutung. Revolutionär war die frontale Darstellung von Gesichtern, dem Ursprung der eigentlichen Portraitmalerei, die nun nicht mehr nur auf herrschende und wohlhabende Personen beschränkt blieb. Auch Szenen des alltäglichen Lebens wurden bereits abgebildet. Populäre Beispiele für Werke aus der Zeit kurz vor der Zeitenwende finden sich vor allem in der altägyptischen Grabmalerei sowie den pompejanischen Fresken, wo sich bereits Allegorie und Aktmalerei zu eigenständigen Kunstformen entwickelten.

Bereits ab dem Jahr 200 etwa verlor die Kunst allgemein an Bedeutung und vor allem auch an Qualität. Viele antike Techniken gerieten mehr und mehr in Vergessenheit, endgültig dann mit dem Ende des weströmischen Reiches. Erst etwa ab dem Jahr 700 existieren wieder erwähnenswerte Zeugnisse künstlerischer Aktivität, vowiegend aus dem chinesischen, arabischen und byzantinischen Raum. Völlig neu war die reine, teilweise bereits mystisch verklärte Landschaftsmalerei fernöstlicher Künstler. Im oströmischen Reich - und ab 800 auch im karolingischen Reich - beschränkte sich die gemalte Darstellung fast ausschließlich auf religiöse Motive. Während bildliche Zeugnisse aus dem mitteleuropäischen Raum vor allem als Buchmalerei erhalten blieben, gewann im oströmischen Reich mehr und mehr die Ikonenmalerei auf Holz (später mit Gold unterlegt) an Bedeutung, die sich im Laufe der Jahre auch nach Russland, dem Balkan und Süditalien ausbreitete.

Der Beginn der Gotik markiert den Zeitpunkt, von dem an sich die Malerei kontinuierlich bis zu ihrer höchsten Blüte entwickelte und als eigenständige Kunstform überragende Bedeutung gewann. In diese Zeit fällt die Verbreitung der Ei-Tempera und später auch der Ölmalerei. Die realistische Abbildung in Form des Portraits setzt sich durch, und die Entdeckung der Zentralperspektive durch Brunelleschi um das Jahr 1420 revolutionierte die bis dahin statische Malerei, in der Personen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gemäß groß oder eher klein dargestellt wurden; und zwar unabhängig von ihrer tatsächlichen Position im Raum. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Jan van Eyck, Giotto, Rogier van der Weyden

Noch immer nehmen religiöse und mythologische Motive breiten Raum ein. Weit größere Bedeutung aber - auch als zeitgeschichtliches Dokument - hat das Portrait adliger oder mächtiger Personen, die in nie dagewesener und nie mehr erreichter Perfektion abgebildet werden. Auch die Darstellung handwerklicher Tätigkeiten oder alltäglicher Szenen spielen erstmals eine tragende Rolle. Der umgebende (Natur-)Raum und die Architektur werden zu eigenständigen Inhalten, und zwar erstmals perspektivisch korrekt. Der stofflichen Qualität von Kleidung und Gegenständen wird oftmals primäre Bedeutung beigemessen. Erstmals werden Materialien so dargestellt, dass Dinge wie Glas, Marmor oder Metall förmlich fühlbar werden. Im Gegenzug verliert Blattgold weitgehend an Bedeutung, zumal sich immer mehr die Ölmalerei auf Leinwand durchsetzt. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Leonardo, Raffael, Tizian, Michelangelo, Botticelli, Dürer

Unter dem Einfluss der Umwälzungen durch die Reformation änderte sich gegen Ende des 16. Jhds. die Kunstauffassung grundlegend. Nicht mehr das Edle, Gute und Göttliche waren kunstbestimmend, sondern Banalität, Gewalt und Lasterhaftigkeit des Menschen. Ausdruck fand die neue Geisteshaltung durch dramatische Lichtstimmungen, üppige, in Bewegung verknäulte Körper und apokalyptische Szenarien. Die Maltechnik wurde mechanischer, farbloser und kraftvoller. Nicht besser, aber doch ehrlicher als noch in der Renaissance. Erstmals auch verließen Künstler ihr Atelier, um "nach der Natur" zu malen. Beim Gemäldeaufbau setzten sich neue Techniken durch und der Farbauftrag erfolgte zunehmend durch Künstler wie Frans Hals oder Rembrandt pastos. Auch das Portrait erlebte einen Wandel: Nicht Vollkommenheit und Perfektion waren nun Ziel der Darstellung, sondern das Wesen des Menschen, der Blick hinter die Fassade. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Caravaggio, Velázquez, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn

Mit dem Ausklang des Barock hellten sich die Bilder auf, die Paletten wurden farbiger, die Personen privater, und die Malerei befreite sich zusehends von ihrer Schwere und Tieflastigkeit. Portrait und Gruppenbildnis waren zentrales Bildthema dieser Epoche, aber auch Mythologie, Alltagsleben und Natur. Die Malerei wurde flächiger, insgesamt einfacher und teilweise fast naiv und verspielt. Der Raum wurde bestimmend, in welchen der Mensch hineinplatziert wurde. Gerade beim Portrait bildete der Hintergrund ein oftmals bestimmendes Element. Auch Naturwissenschaft, Technik und Architektur werden zunehmend zu alleinigen Sujets. Das Fresko gewann auch außerhalb des höfischen Lebens als Kunstform enormes Gewicht. Das unnachgiebige Festhalten an der bestehenden Ordnung, aller Gewissheit zum Trotz, dass die Zeiten sich alsbald grundlegend wandeln: in der Kunst des Rokoko wird dies sukzessive spürbar. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Thomas Gainsborough, Tiepolo, Antoine Watteau

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es erstmals dazu, dass sich parallel gleich mehrere Kunstströmungen entwickelten. Während die Romantik als Kunstform mit ihrer Rückbesinnung auf die Sagen- und Heldenwelt des Mittelalters und der ungezähmten Natur vorrangig ein deutsches Phänomen blieb, setzte sich konträr dazu der Klassizimus mit all seinen Ausprägungen als akademische Kunstform durch, vor allem in Frankreich. Und während die Romantiker auf ihrer Suche nach wahrhaftigen Werten das Geheimnisvolle der Natur und der Rolle des Menschen darin zu ergründen suchten, wandten sich die Klassizisten auf ihrer Suche nach Vollkommenheit und Perfektion verstärkt den Idealen der Antike zu. In der Folge entwickelten sich nicht nur parallel unterschiedliche Kunstauffassungen, sondern auch vollkommen gegensätzliche Maltechniken. Letztendlich ist der Klassizismus die verbreitete, technische Kunstform dieser Zeit, aus der sich der Realismus ableitete. Die Romantik hingegen mit ihrer ausgepägten, spielerischen Farbigkeit war visionär und bereitete den Weg für den Impressionismus. Bedeutende Vertreter dieser Epochen: Joseph Turner, Jean A. D. Ingres, Jacques-Louis David, Francesco Hayez, C. D. Friedrich

Parallel zum Klassizismus entstanden zwei neue Kunstrichtungen: Während der Realismus sich vor allem zuerst in Russland als vorherrschende Stilrichtung etablierte, entwickelte sich in deutschen Ländern aus der Romantik die Kunst des Biedermeier. Der Realismus in der Malerei bezieht sich dabei nicht nur auf die Maltechnik, sondern auch auf die Sujets: Das Leben der einfachen Leute wird gezeigt wie es ist. Idealisierung und Verklärung sind verpönt. Religion und Adel als Thema spielen - wie auch im Biedermeier - nur noch als Auftragsarbeit eine Rolle. Doch während viele Werke des Biedermeier durch Lebensfreude und Humor eine nie gekannte Leichtigkeit zeigen, ist gerade das realistische Element des Realismus, nämlich die wirklichkeitsgetreue Darstellung, immer auch Gegenstand der Kritik. Malern des Realismus wird nicht selten Phantasielosigkeit und mangelnde Fähigkeit zur Interpretation vorgeworfen. Dennoch hat gerade der Realismus mit seinen späteren Unterformen wie Sozialistischer Realismus oder Fotorealismus bis in unsere heutige Zeit als eigenständige und anerkannt akademische Kunstform überlebt, auch wenn ihm angesichts von Fotografie und Drucktechniken viele seine Sinnhaftigkeit absprechen. Bedeutende Vertreter dieser Epochen: Gustave Courbet, Carl Spitzweg, F. X. Winterhalter
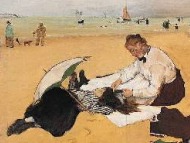
Mitte des 19. Jhds. verließen vor allem in Frankreich immer mehr Künstler ihr Atelier, um direkt in der Natur zu malen. Dies verlangte nach einer neuen, sehr schnellen Malweise und bedeutete die Abkehr von altmeisterlichen Techniken. Farbe an sich und ihr rascher Auftrag wurden der formalen Korrektheit übergeordnet und zum primären, gestalterischen Element. Ziel der Impressionisten war es, Stimmungen und natürliches Licht einzufangen, was damals ein revolutionärer, vielfach gescholtener Ansatz war. Anfangs noch verhalten umgesetzt, führte der Impressionismus im Laufe seiner Weiterentwicklung immer stärker in die Abstraktion bis hin zur völligen Auflösung der Form und war somit Wegbereiter für die nachfolgenden Kunstformen Fauvismus, Kubismus und Expressionismus. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Edgar Degas, Auguste Renoir, Edouard Manet, Claude Monet
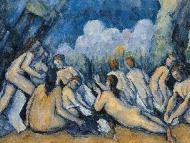
Mit dem Post- oder auch Neo-Impressionismus verlor die Realität in der Kunst endgültig ihre Bedeutung. Die Farbe und die Art des Farbauftrages waren jetzt die bestimmenden Faktoren, unter Aufgabe klassischer Hell-Dunkelmalerei und räumlicher Wirkung. Diese neue Malweise gipfelte im nicht mehr eindeutig definierbaren Fauvismus, der als erste Kunstrichtung der klassischen Moderne gilt, ohne überhaupt eine eigenständige Kunstrichtung zu sein. Weg vom flüchtigen Element des Impressionismus, hin zu mehr Konsistenz durch kräftige Farbe. Eine klare Definition ist das nicht. Und so wird mal der eine, mal der andere Künstler dieser Stilrichtung hinzugezählt, wobei lediglich Einigkeit darüber herrscht, dass durch fauves (zu deutsch: wilde Bestien), eine künstlerische Stilrichtung ohnehin nicht treffend beschrieben werden kann. Genau betrachtet ist der Fauvismus also weniger eine Stilform als vielmehr eine individuelle Malweise, die sämtliche Entwicklungen und Erkenntnisse aller vorangegangenen Jahrhunderte über den Haufen wirft, und dabei sogar auf Perspektive und Dreidimensionalität weitgehend verzichtet. Bedeutende Vertreter dieser Epochen: Vincent van Gogh, Henri Matisse, Paul Cezanne, Paul Gaugin

Den Jugendstil darf man eigentlich nicht als eigenständige, klar definierte Stilrichtung der Malerei betreachten. Während die Impressionisten eine vollkommen neue, eigene Kunstauffassung repräsentierten, gab es auch eine Bewegung, die die klassische Malerei zwar als Ideal akzeptierte, sich aber dennoch gegen akademische Bevormundung und Historismus wandte. Zentren dieser Art nouveau-Bewegung waren München und Wien, die widerum kein einheitlicher Kunststil prägte und in anderen Ländern zu vollkommen anderen Entwicklungen führte. Der Begriff Secession in diesem Zusammenhang bezeichnet lediglich Künstlerverbünde, die eben nicht alle dem Jugendstil hinzugerechnet werden können, wie z.B. Max Liebermann als Mitglied der Münchner Secession. Dem Jugendstil gemein ist höchstens die figurative, gegenständliche Malerei mit eher verhaltener Farbgebung und klar strukturierter Komposition. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Franz von Stuck, Odilon Redon, Gustav Klimt
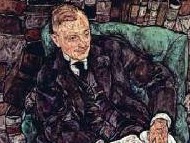
Ende des 19. Jhds. fand als Pendant zum französischen Fauvismus im deutschspachigen Raum ein neue Kunstauffassung Verbreitung, die den freien Umgang mit Farbe, Form, Licht und Raum propagierte. Künstlerisches Schaffen sollte nicht nicht mehr akademische Auffassung und Ausbildung voraussetzen. Bereits mit Malern wie Cézanne oder Munch verlor die Realität in der Darstellung zunehmend an Gewicht. Das Gedachte, das Empfundene, wurde wichtiger als das Gesehende. Um ihrer Kunstauffassung mehr Bedeutung und Gehör zu verleihen, schlossen sich viele Maler in Künstlerbünden zusammen, deren bekannteste Brücke und Blauer Reiter waren. Ein einheitlicher Kunststil prägt den Expressionismus aber eher nicht, zumal die Grenzen zum Fauvismus, dem Symbolismus, dem Kubismus und zunehmend auch zur abstrakten Malerei fließend sind und keine genauere Definition erlauben. So erlaubt der Expressionismus erstmals auch Hobby- und Freizeitmalern eine Malerei, die nicht sofort als dilettantische Kunst zu erkennen sein muss. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: August Macke, Franz Marc, Egon Schiele, Ernst Ludwig Kirchner

Die Epoche des Kubismus währte nur kurz, hat aber noch heute Bedeutung und findet sich als Stilmittel in Werken zeitgenössischer Künstler. Revolutionäre oder gar anarchistische Ideen liegen dem Kubismus nicht zugrunde. Vielmehr ist er die konsequente Entwicklung der bereits mit den vorangegangenen Stilepochen Reduzierung der Malerei auf die Farbe. Licht und Raum sind nicht mehr definiert, und die Form löst sich auf und wird deformiert oder gar zweidimensional. Vorder- und Hintergrund des Motivs sollen in harmonischen Einklang gebracht werden, ohne, dass auf Dinge wie Perspektive oder Lichteinfall Rücksicht genommen werden muss. Nach dem Frühkubismus wird in den analytischen sowie den synthetischen Kubismus unterschieden. Während bei ersterem jeder Bezug zum Raum aufgehoben ist, greift letzterer auf die Collage-Technik zurück in der Absicht, eine illusionistische Perspektive mit der Simultanansichtigkeit des Gegenständlichen zu kombinieren. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris

Anfang der 1920er-Jahre spaltete sich von den Dadaisten, die die Sinnlosigkeit und Irrationalität in der Kunst propagierten, eine neue gegenständliche Kunstrichtung ab, die eine ganz eigene Ästhetik entwickelte, in dem sie die Realität überzeichnete. Träume und Visionen, Spiritualität und Mythologie wurden nun zum Gegenstand von Gemälden und Plastiken, die dem Betrachter teilweise auch durch verdrehte Perspektiven, verfälschte Räumlichkeit und abstrakte Elemente einen breiten Spielraum zur Interpretation ließen. Das Reale wurde dabei nicht selten bis zur Unkenntlichkeit oder dem Absurden übersteigert. Als eine der wenigen Stilrichtungen der Bildenen Kunst hat der Surrelismus bis in die heutige Zeit überdauert, auch wenn vom ursprünglich revolutionären, intellektuell herausfordenden Ansatz nicht mehr viel übrig blieb als rein dekorative Malerei. Bedeutende Vertreter dieser Epoche: Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte